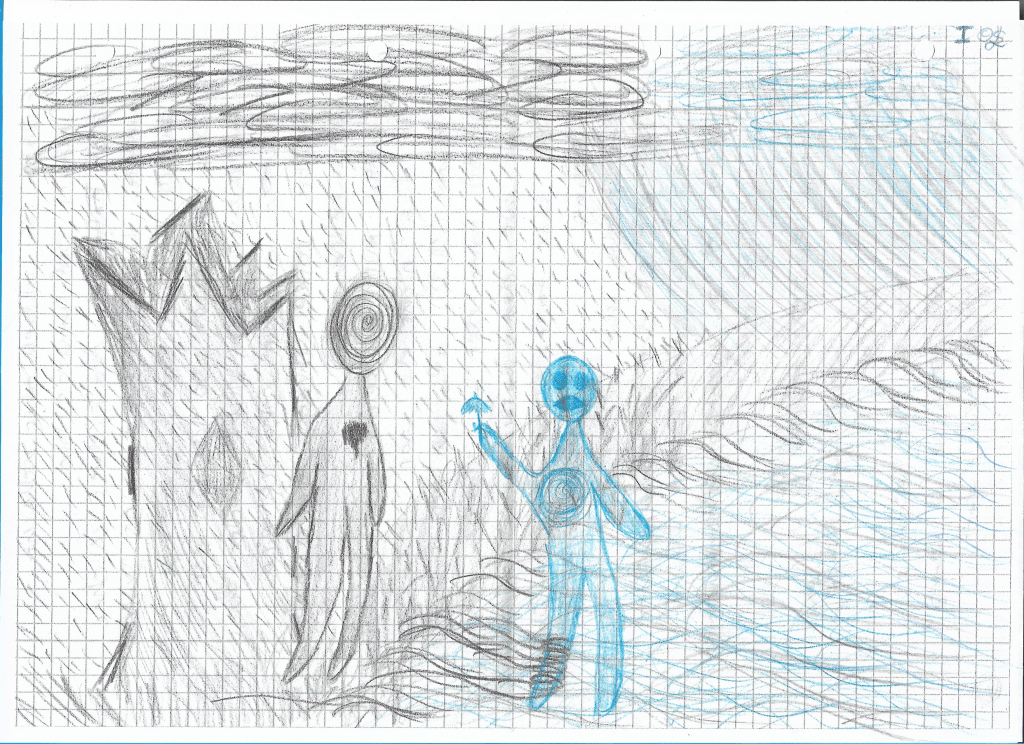
Fußabdrücke im Sumpf
„Come ti chiami?“, chiese. „Parole.“
(„Wie nennst du dich?“, fragte er. „Wörter.“)
Erinnerungen, kleine Fetzen, die alsbald zu einer Decke sich verknüpfen lassen unter der ein Mensch ewig schläft und eine andere Welt geschaffen wird.
„Cosa vuoi?“, chiese. „Solo gioccare, gioccare per sempre.“
(“Was willst du?”, fragte er. ”Nur spielen, für immer spielen.“)
Ein grauer Raum gefüllt mit einem grauen Tisch, einem grauen Stuhl, einem grauen Schaukelpferd und alles ist unsichtbar wie ein Rochen auf dem Meeresgrund in grau gehüllt.
„Dove sei?“, chiese. „Non lo so.“
(“Wo bist du?”, fragte er. „Das weiß ich nicht.“)
Weiße Wolken werfen dunkle Schatten auf die schwarze Wüste. Das Atmen fällt schwer, denn die Luft ist dünn und erfüllt von schwefeligen Dämpfen. Selbst die Steine sind einsam, nebeneinander liegend und doch zu verschieden um sich im anderen wiederzuerkennen. Fliehen ist ausgeschlossen solange es nicht erreicht, das Geheimnis nicht entschlüsselt wurde. Die Neugierde im Nacken überholen sich die Füße.
„Com’è successo?“, chiese. „Era un incidente.“
(„Wie ist das passiert?“, fragte er. „Es war ein Unfall.“)
Seelenruhig trieb das Quietscheentchen auf dem offenen Meer, als sich plötzlich eine Welle erhob und es unter sich begrub. Es taumelte und strauchelte. Es war überwältigend. Es wusste gar nicht, dass es so lange tauchen konnte. Unfähig sich zu wehren sinkt es auf den Grund, wo es sicher ist vor den Unregelmäßigkeiten der Oberfläche.
„Come stai?“, chiese. „Non importa.“
(“Wie geht es dir?”, fragte er. „Das ist nicht wichtig.“)
Statuen sind standhaft. Ein Pirat ist furchtlos. Die Aphrodite ist schön. Rosen sind rot. Ein Vogel ist frei. Wörter sind mehrdeutig. Ein Haufen Scheiße ist nichts von alle dem.
„Hai capito?“, chiese. „Non ho un cervello.“
(“Hast du verstanden?”, fragte er. „Ich habe kein Gehirn.“)
Es nutzt dem Fisch nichts, dass er Augen hat, wenn er in verdrecktem Wasser schwimmt. Es hilft dem Affen nicht, dass er Hände hat, wenn kein Ast da ist, an dem er sich festhalten kann. Es dient dem Zebra nicht, dass es Hufe hat, wenn um es herum eine Mauer errichtet wird. Es bringt den Menschen nicht weiter, dass er Gefühle hat, wenn er sie doch nicht ausspricht.
„Ti spieghi?“, chiese. „Non me lo arrogo.“
(“Erklärst du dich?”, fragte er. „Das maße ich mir nicht an.“)
Niemand ist an Bord, doch die Leinen werden los gemacht und der Anker gelichtet. Aufgebrochen zur Reise ohne Wiederkehr, auf der jeder verloren gegangen ist bevor sie überhaupt beginnt.
„Dove vai?“, chiese. „Lontano.“
(„Wohin gehst du?“, fragte er. „Weit weg.“)
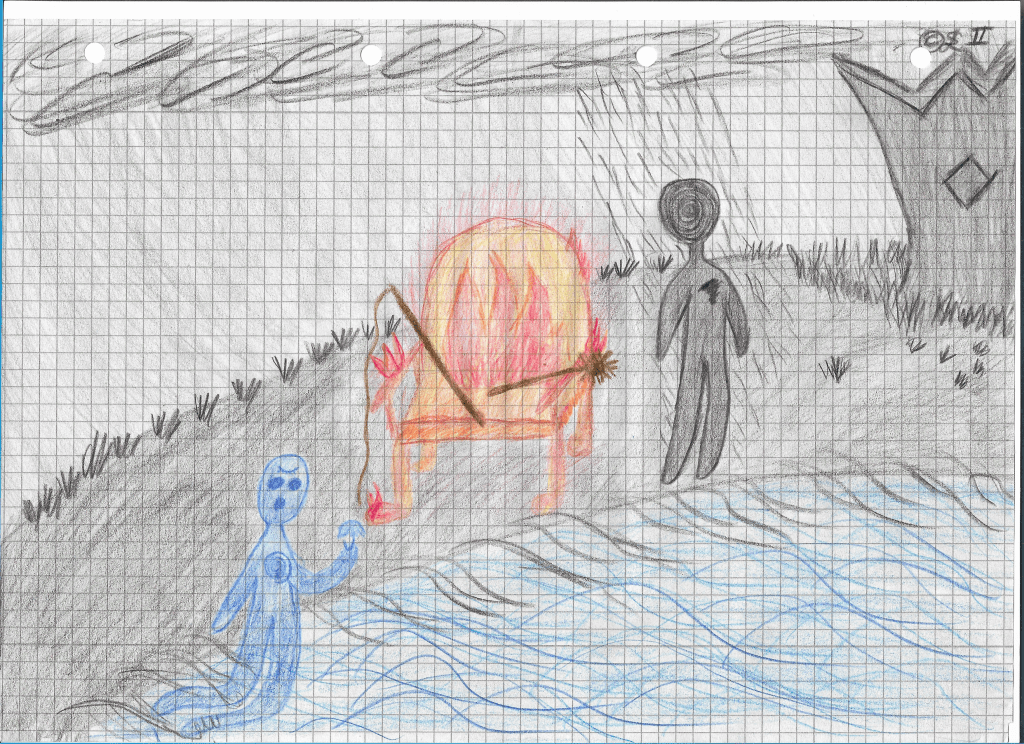
Unser Kampf – Elegien eines zweigeteilten Herzens XV
Sie ist eine Wüste und wandelt in ihr.
Hier gibt es weder Wind noch Wasser.
Die Sonne geht stetig auf, doch nie steigt sie. Unangenehm blendet ihr Licht.
Sie kann den Stift nicht halten und versinkt im Sand.
Im Sand ist die Wüste noch die selbe. Sie wandert weiter.
Ein unerwarteter Wind streicht ihr durchs Haar. Sie weint.
Vor ihr geht ihr langer Schatten. Unermüdlich spottet er ihrer Qual.
Sie geht langsam mit gebeugtem Haupt. Schwer lastet die Verlorenheit auf ihr.
Wo soll sie Wasser finden? Wo leben?
Sie geht weiter ohne Ziel.
Der Weg hinter ihr ist nicht mehr zu erkennen. Sie Sonne verzerrt die Sicht.
War es schon immer so?
Ihr Schatten schwindet. Sie hält inne.
Übrig bleibt nur ein Finger. Ein kleiner Strich im Sand.
Nein, es ist ein Stift.
Die Sonne brennt noch heißer, doch an der selben Stelle.
Sie bleibt die Wüste und die Wüste in ihr.
Doch blickt sie nun zurück.
Den Weg, der jetzt hinter ihr liegt, ist sie noch nicht gegangen.
Obgleich sie nicht sehen kann, wohin sie geht,
wendet sie sich um und sucht den Weg.
Der Sonne und Ungewissheit zum Trotz.
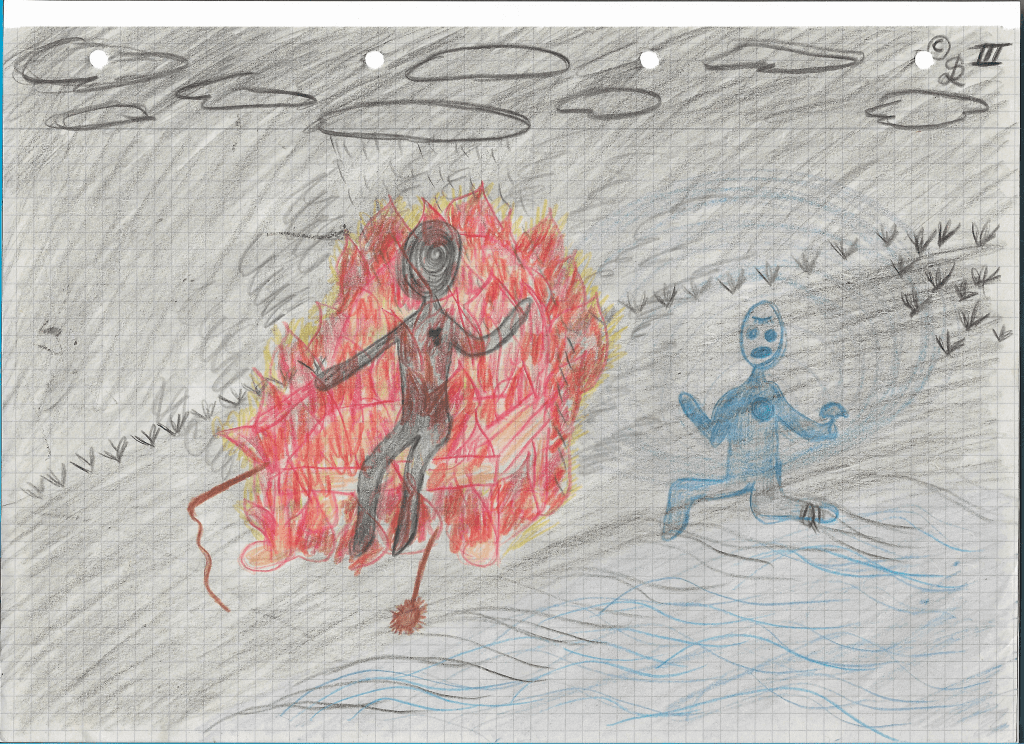
Wenn etwas das Herz erreicht
Die Sirene sitzt auf ihrem Felsen. Anmutig, kalt, fröhlich und traurig zugleich. Sie singt ihr Lied und lockt damit ahnungslose Seefahrer in den sicheren Tod. Ihr Haar zerzaust vom Wind, trägt jener den Klang ihrer Stimme und die unheilvollen Worte sanft über das Meer.
“Folge mir hinab in das stille Reich,
Finde mich, lass dich halten,
ich bin allein bis du mit mir tanzt.
Komm zu mir,
ich bette dich auf sanft wiegenden Algen.
Alles ist dunkel bis dein Licht die Tiefe erhellt.
Folge mir hinab in mein stilles Reich,
sink in meine Arme ewiglich.”
So sitzt sie und singt. Immer auf der Suche nach Etwas, das ihr Herz erreicht. Schiff um Schiff zerschellen an den Klippen. Nacht um Nacht tanzt sie mit den Seelen der ertrunkenen Seeleute, bevor sie alle in den sanft wiegenden Algen zur Ruhe bettet. Doch ihr Herz bleibt anmutig und kalt.
Und dann, einfach so, den Naturgesetzen zum Trotz beginnt, zunächst unbemerkt, auf der kargen, von Wind und Wasser gepeitschten Klippe Etwas zu wachsen. Die Sirene bemerkt die Veränderung und beobachtet voller Erwartung das seltsame Ereignis. Die Tage werden länger, das Meer ruhiger und klarer. Die Sirene sitzt stumm auf ihrem Felsen und sieht gebannt nur noch dem monotonen Reigen der Blume zwischen den Steinen zu, die mit ihrem Kopf stets dem Lauf der Sonne folgt. Jeden Tag sitzt sie nun dort in andächtiger Ehrfurcht und mit bewegtem Herzen. Jede Nacht tanzt sie allein, aber erfüllt voll Hoffnung auf den nächsten Morgen.
Eines Tages scheint die Sonne besonders stark und brennt erbarmungslos auf das Land. Die Sonnenblume lässt den Kopf hängen und trifft den Blick der Sirene. Schwach flüstert sie: „Wasser. Ich brauche Wasser.” Überrascht und überwältigt kommt die Sirene näher und wässert den Boden, in dem die Sonnenblume wächst. Sie bleibt und atmet zum ersten Mal auch den Duft der Blume ein. Die Sonnenblume, gestärkt vom Wasser, hebt ihren Blick dem Himmel entgegen. „Hallo”, sagt die Sirene vorsichtig und fügt hinzu, „du tanzt schön. Ich betrachte dich gern.” „Danke”, erwidert die Blume fast beiläufig, „ich bin nur eine Blume. Ich folge meiner Natur. Da ist gar nichts dabei.” Die Sirene stutzt: „Wie kann es dann sein, dass ich so etwas wie dich noch nie zuvor gesehen habe? Mein Reich ist groß, voll Dunkelheit und Stille. Ich kann die Dunkelheit kurzweilig mit den Seelen Ertrunkener erhelle. Ich kann die Stille mit meiner Stimme vertreiben. Aber nichts davon ist von Dauer. Du hingegen strahlst jeden Tag. Weder entlang der Küste, noch weit und breit im Meer gibt es Etwas vergleichbares.” „Ich bin eine Blume. Ich wachse in der Erde. Die Sonne und der Regen nähren mich. Ich brauche nichts weiter”, gibt die Blume abwehrend und als hätte sie gar nicht richtig zugehört zurück. „Ich wünschte”, sagt die Sirene zögerlich, „ich könnte es dir zeigen.” „Wenn du mich pflückst”, antwortet die Sonnenblume, „werde ich in wenigen Tagen vergehen.”
Die Nacht senkt sich und die Sirene gleitet zurück ins Meer. Dennoch erfreut sie sich weiterhin jeden Tag an dem Tanz der Blume. Deren letzter Blick jeden Abend der abtauchenden Sirene gilt, bevor er unweigerlich zu Boden fällt. Die Sirene gibt der Blume Wasser, wenn es nicht genügend regnet, aber sie wagt es nicht mehr sie anzusprechen. Die Sonnenblume tanzt. Die Sirene glaubt das Leben würde fortan ewig so weiter gehen. In der Sonnenblume wachsen Zweifel.
Dann wird es Herbst. Ohne ‚lebe wohl‘ zu sagen, ohne ein letztes Wort verwelkt die Sonnenblume so wundersam wie sie entstand. Die Sirene sitzt auf ihrem Felsen und schreit. Ergriffen von Verzweiflung rennen ihre Tränen ins Meer.
Entschlossen greift sie zu einer scharfen Muschel, die an ihrem Felsen hängt. Sie setzt die Muschel wie ein Messer an ihrem Hals an. Einige Kraft ist dazu nötig. Sie öffnet ihren Brustkorb. Blut fließt. Sie fällt rücklings auf ihren Felsen. Doch dann fliegen unzählige Schmetterlinge aus ihrem reglosen Körper. Sie sammeln die Samen der Blume auf und tragen sie in alle Richtungen davon.
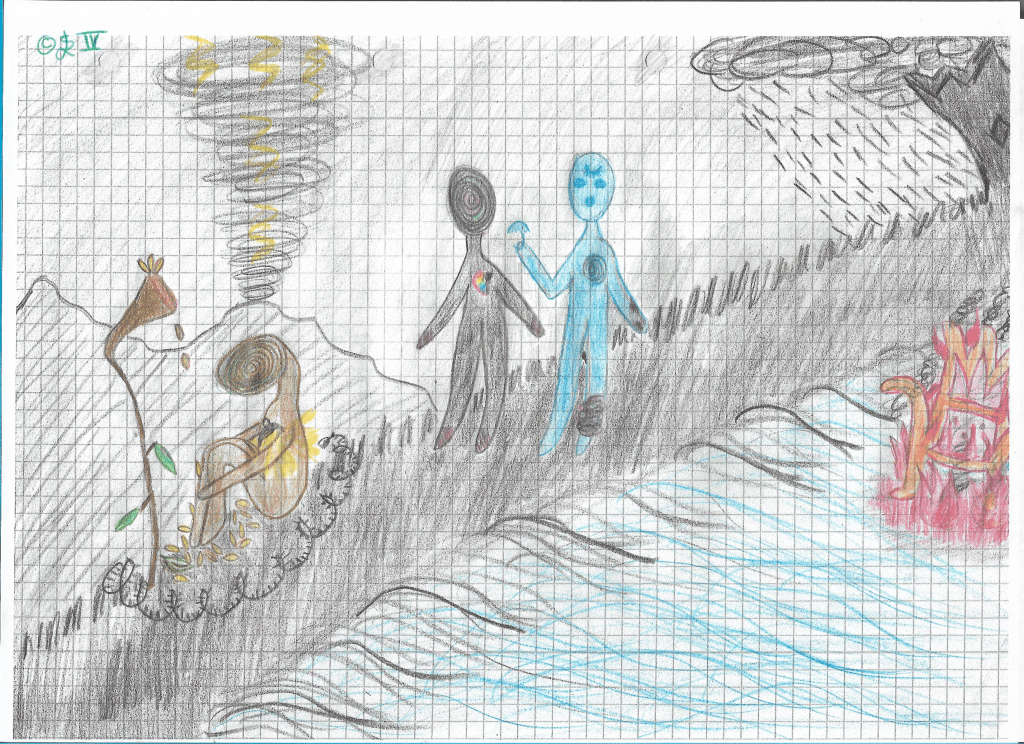
Mit
Ich habe eine Sprache gefunden,
in der ich dir sagen kann …
Siehst du mich?
Mi vedi?
Ich habe eine Sprache gefunden,
in der ich dir sagen kann …
Fühlst du mich?
Mi senti?
Ich habe eine Sprache gefunden,
in der ich dir sagen kann …
Verstehst du mich?
Mi capisci?
Ho trovato finalmente una lingua
per farti vedere, farti sentire, farti capire.
Ich habe eine Sprache gefunden,
um dich sehen zu lassen, dich fühlen zu lassen, dich verstehen zu lassen.
Siehst du mich jetzt?
Spürst du mich jetzt?
Verstehst du mich jetzt?
Mit deinen Augen.
Mit deinen Händen.
Mit deinem Herzen.
Oder meinem?
Es schreit dir entgegen,
es ist unerbittlich,
es hört nicht auf,
es wird lauter.
Ich habe eine Sprache gefunden,
in der ich dir sagen kann …
Warum hörst du nicht zu?
Mit deinem Herzen.

Unser Kampf – Elegien eines zweigeteilten Herzens – XXV (random)
So wie den Regenbogen,
gibt es dich nicht
und doch blicke ich jeden Tag in dein Gesicht.
So wie du gestern warst,
bist du heute nicht mehr,
weder den von gestern noch den von heute geb‘ ich je her.
So bist du doch mein Traum allein,
erfasst in der Erfahrung eines fließenden Seins.
Und träum ich, wir wären Tropfen,
die an die Wand des Anderen Herzen klopfen,
es beleben,
zum Schweben erheben,
Teil des Andren werden
zwischen Sinn und Verderben.
Ob zum Niedergang und Verfall verschworen,
oder zur Wiederentdeckung der Liebe geboren.
Aus zwei wird eins, wo nichts ist.
Und ich hab‘ dich hier noch nie vermisst.